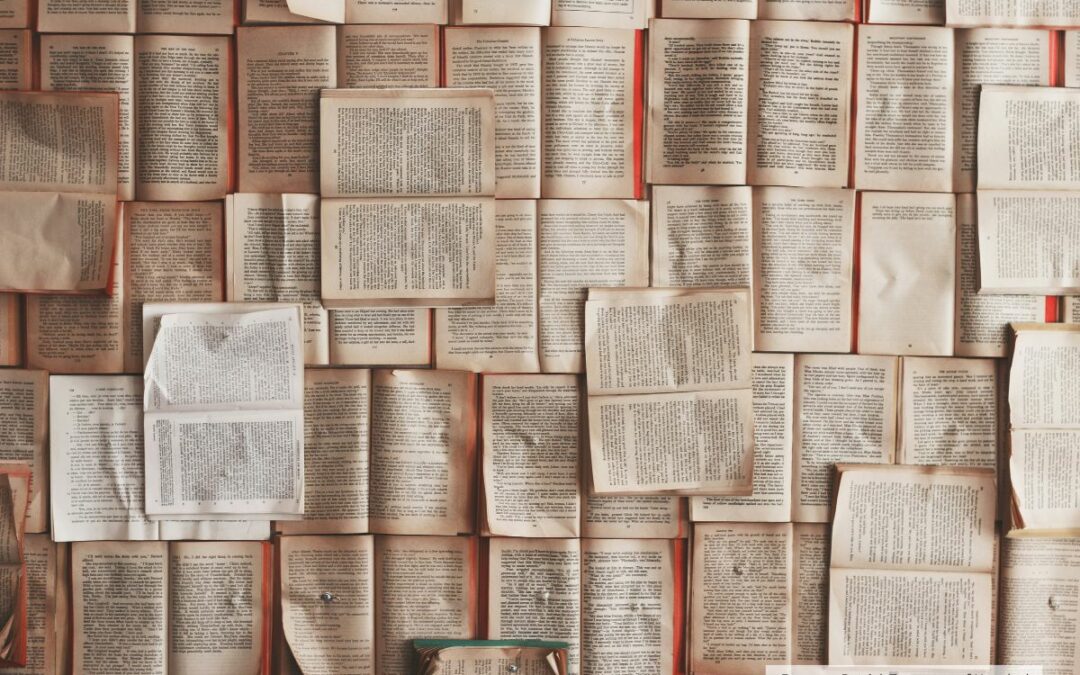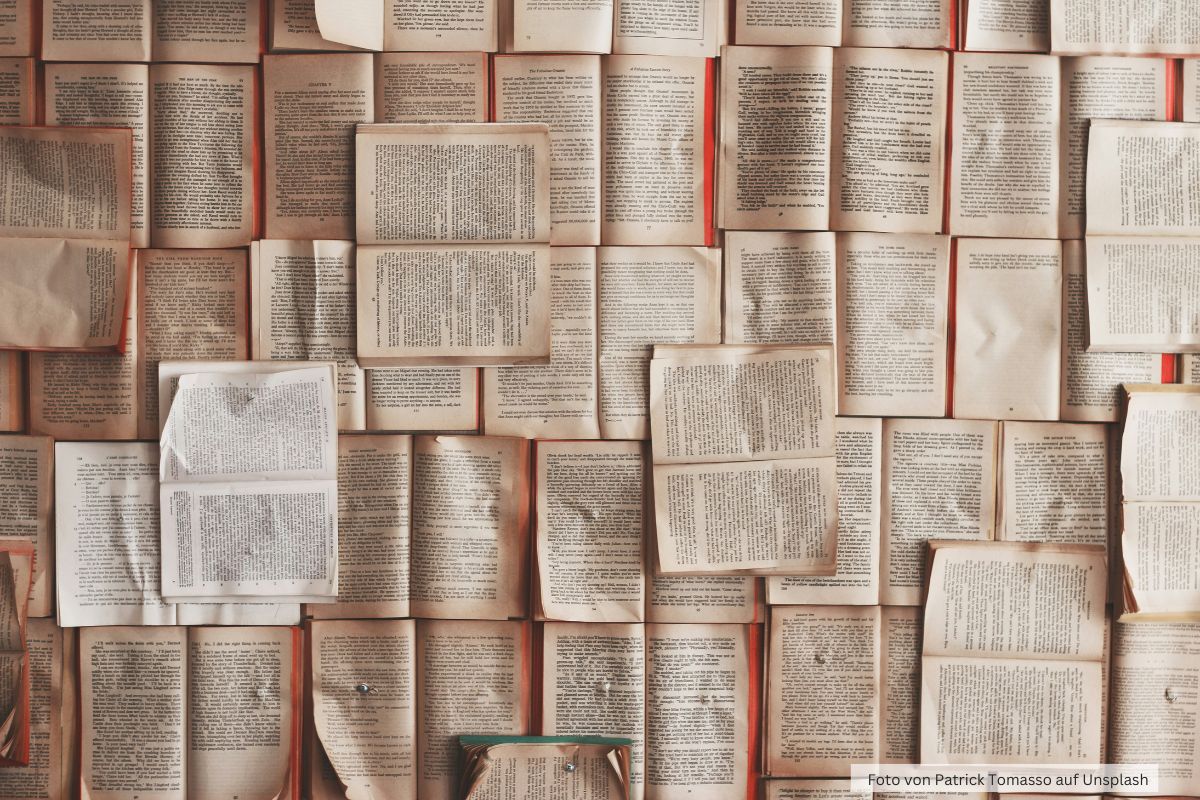
Foto von Patrick Tomasso auf Unsplash
Wir alle haben bestimmte Glaubenssätze und Grundannahmen, über die Welt, über uns, darüber wie die Dinge sind und sein sollten. Sie helfen uns, zu verstehen, einzuordnen, zu interpretieren und zu bewerten. Damit dienen sie als unerlässliche Orientierungshilfe und Erklärungsmodell für die Welt, gleichzeitig prägen sie aber gleichzeitig die Sicht auf sich selbst und das Leben.
Dass das, was wir glauben, weitreichende Folgen auf unser Leben und unsere Persönlichkeit haben kann, unabhängig davon, wie „real“ es tatsächlich ist, zeigen z. B. Studien zum Placebo-Effekt immer wieder eindrücklich. Und auch in der Psychologie sind die „selbsterfüllende Prophezeiung“ oder (besonders für Wissenschaftler:innen interessant) der Rosenthal-Effekt (https://de.wikipedia.org/wiki/Rosenthal-Effekt) bestens bekannt und untersucht. Umso wichtiger ist es, dass wir uns regelmäßig unsere Grundannahmen und Glaubenssätze bewusst machen und hinterfragen, um eventuelle schädliche Auswirkungen einzudämmen, mit denen wir uns ansonsten selbst im Weg stehen. Aber ist das alleine wirklich ausreichend?
Wenn Glaubenssätze gesellschaftsfähig werden: die Macht der Narrative
Individuelle Glaubenssätze sind tief verwurzelte, oft unbewusste Überzeugungen, die unser Denken, Fühlen und Handeln prägen. Sie entstehen schon in der Kindheit und frühen Jugend durch Erfahrungen und Bezugspersonen. Gesellschaftliche Narrative hingegen sind geteilte Erzählungen und Deutungsmuster, die eine bestimmte Sicht auf die Welt und z. B. politische Ideologien konstruieren.
Der Zusammenhang zwischen beiden besteht nun darin, dass gesellschaftliche Narrative einerseits auf individuellen Glaubenssätzen aufbauen und diese widerspiegeln. Andererseits prägen und verstärken dominante gesellschaftliche Narrative auch die Entstehung individueller Glaubenssätze. Es besteht also eine eindeutige Wechselwirkung:
👉 Individuelle Glaubenssätze speisen sich aus den vorherrschenden Narrativen einer Gesellschaft und werden dadurch mitgeformt.
👉 Gleichzeitig manifestieren sich in gesellschaftlichen Narrativen die gesammelten individuellen Glaubenssätze der Menschen.
👉 Narrative werden durch Interpretation und Affizierung des Publikums zu einer selbst-erfüllenden Praxis, die wiederum Glaubenssätze beeinflusst.
👉 Glaubenssätze motivieren und prägen Personen, beeinflussen politische Ergebnisse und tragen so zur Entstehung und Verbreitung neuer Narrative bei.
Dies zeigt, wie eng individuelle Glaubenssätze und gesellschaftliche Narrative miteinander verwoben sind. Sie bedingen sich gegenseitig. Narrative greifen individuelle Glaubenssätze auf und formen sie, während Glaubenssätze die Basis für die Entstehung und Akzeptanz von Narrativen bilden.
Wie ist das in der Wissenschaft?
Gerade im wissenschaftlichen System wirken immer noch erschreckend viele Narrative auf alle Beteiligten, die voll von unbewiesenen oder sogar klar widerlegten Grundannahmen sind, wie z. B. dass ein:e Wissenschaftler:in 24/7 arbeiten muss, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein (da scheinen Wissenschaftler:innen grundsätzlich anders zu funktionieren als andere Lebewesen, für die regelmäßige Ruhephasen lebenswichtig sind), dass gute Wissenschaft in erster Linie mit Talent zu tun hat und wer kein Talent hat, der fliegt halt irgendwann (zu recht) raus (fixed mindset de luxe!) sowie der Idee, dass mit der Berufung automatisch die Omnipotenz verliehen wird, inklusive grundsätzlicher sozialer Kompetenzen z. B. in den Bereichen Führung, Kommunikation oder sogar Lehre (denn wenn dem nicht so wäre, dann müssten diese Kompetenzen in Berufungsverfahren sicherlich eine sehr viel größere Rolle spielen). Einen spannenden Überblick, wie verheerend solche Narrative auf die Betroffenen haben können und wie sie die prekären Verhältnisse im System Wissenschaft fundieren, gibt übrigens dieser Artikel von Kristin Eichhorn: https://www.linkedin.com/pulse/die-angst-vor-der-zweifachen-inkompetenz-kristin-eichhorn-ztwee/?trackingId=qtB8vQ7ASk6Ez65AXA21Eg%3D%3D.
Das perfide an diesen Narrativen ist, wie oben beschrieben, dass sie un(ter)bewusst aus dem System direkt in die Köpfe der Betroffenen wandern, sich dort als unhinterfragte Glaubenssätze festsetzen und wirken. Und so auch ständig weiter perpetuiert werden.
Was kannst Du dagegen tun?
Es kann für den oder die Einzelne:n sehr herausfordernd sein, sich gegen diese Narrative und Glaubenssätze zu wehren, die ständig im eigenen Umfeld vertreten werden. Hier sind einige Strategien, die dir dabei helfen können:
💪Sei dir deiner eigenen Werte und Überzeugungen bewusst. Reflektiere, was für dich wirklich wichtig ist und woran du fest glaubst. Diese innere Klarheit kann dir Halt geben.
💪 Hinterfrage kritisch die Glaubenssätze deines Umfelds. Prüfe die Fakten und Logik hinter ihren Aussagen. Lass dich nicht von bloßen Behauptungen überzeugen.
💪 Suche nach Gegenbeispielen und alternativen Sichtweisen, die den Glaubenssätzen deines Umfelds widersprechen. Das kann deine eigene Perspektive stärken.
💪 Baue dir ein unterstützendes Umfeld auf, das deine Werte und Überzeugungen teilt. Gleichgesinnte können dich darin bestärken, deinen eigenen Weg zu gehen.
💪 Grenze dich bewusst von Personen ab, die toxische (oder auch extremistische) Glaubenssätze vertreten. Reduziere den Kontakt, wenn nötig.
💪 Arbeite an deinem Selbstwertgefühl und deiner inneren Stärke. Je selbstsicherer du bist, desto weniger lässt du dich von fremden Glaubenssätzen verunsichern.
💪 Suche professionelle Hilfe, wenn du alleine nicht weiterkommst, z.B. durch Coaching oder Therapie.
Der Schlüssel ist, deine eigenen Werte und Überzeugungen klar zu definieren und dich nicht von Glaubenssätzen aus deinem Umfeld beirren zu lassen. Vielleicht kannst du dein Umfeld nicht (sofort) umfassend ändern, aber mit der richtigen Strategie und Unterstützung kannst du vielleicht zumindest dich selbst in ausreichendem Maß abgrenzen und „immunisieren“. Und dann als gutes Beispiel und Vorbild für andere wirken.
Hat Dir dieser Beitrag gefallen? Dann schau dir doch auch mal hier:

Die Spülmaschine als Produktivitäts-Booster
Die Spülmaschine als Produktivitäts-Booster: Wie kleine Aufgaben Deine Motivation pushen können Seit Wochen stand es auf meiner To-Do-Liste: Ein Beitrag für die Festschrift meiner Doktormutter. Eine Aufgabe, die mir eigentlich am Herzen liegt, und doch fand ich mich...

Zwischen Überforderung und Machtmissbrauch: Warum gesunde Wissenschaft gesunde Professor:innen braucht
Zwischen Überforderung und Machtmissbrauch: Warum gesunde Wissenschaft gesunde Professor:innen brauchtDie Diskussion um Machtmissbrauch an deutschen Hochschulen flammt immer wieder auf – zuletzt etwa durch die Berichterstattung in internationalen Fachmedien (Gewin,...

Zwischen Überforderung und Machtmissbrauch: Warum gesunde Wissenschaft gesunde Professor:innen braucht
Zwischen Überforderung und Machtmissbrauch: Warum gesunde Wissenschaft gesunde Professor:innen brauchtDie Diskussion um Machtmissbrauch an deutschen Hochschulen flammt immer wieder auf – zuletzt etwa durch die Berichterstattung in internationalen Fachmedien (Gewin,...